„Atem anhalten“ heißt der soeben erschienene Band gesammelter Gedichte der Autorin Gerlind Reinshagen. Er gerät ins Stocken, weil man vergisst, sich bei der Lektüre um Selbstverständlichkeiten wie die Sauerstoffzufuhr zu kümmern. Das liegt an der Gedankenfülle, an den facettenreichen, weitreichenden Themen, die sich von einer Kindheit im Krieg, über die Nachkriegszeit, bis ins digitale Zeitalter erstrecken.
In „Teufelsmützen“ etwa spielen sich die Kinder durch den Krieg, die „lausigen Zeiten“. Den Umgang mit dem Tod, dem unbegreiflichen Verschwinden geliebter Menschen, wird auf kindlich-naive Weise begegnet. Die Rolle der Schule wird dabei in „An die Schule“ mit einem Augenzwinkern als unzerstörbares, alles überdauerndes Korsett des Lebens beschrieben:
O du Unsterbliche/Blindschleiche/Im Watteverband/Endlos belegte Zunge/Du/Unterm Bleidach/Verkochst du die Zeit/Zu Sülze/Mahlst mein Herz/Mir zu Staub/Meine Liebe zu Kreide/Für meine Lieder/Ist nur noch/In der Latrine Platz/Für den Sprung aus dem Fenster/Bist du/Zu flach
Mit „Nachkrieg oder die Davongekommenen“ sind die Gedichte übertitelt, die das (Über)leben thematisieren. Das Ich erinnert sich in „November“ an die „Schlupfwinkel“ an die „Nester die heimlichen Höhlen“, sucht nach „kleinen Zeichen an der Mauer“, die darauf verweisen, dass nach dem Krieg etwas lebendig geblieben ist, etwas überdauert hat. Die Erde selbst wirkt „armselig“, ist „unter den glühenden Sternen“ ein „kleiner alter verschrumpelter Ball“, ein „verlorenes Spielzeug.“
Von der negativen Seite der wiedergewonnenen Freiheit berichtet ein kriegsversehrter Soldat („Körperverletzung“), der unter den erfahrenen Traumata leidet, beim Schneiden der Hecke vor dem trauten Heim zu zittern anfängt:
„(…) Frieden vertrag ich nicht/Und Gartenscheren Freunde sind nichts für solche/Die der Krieg erzogen hat/Freiheit raubt Schlaf/Hier hinter schwedischen Gardinen werd ich still/lasst mir das Gitter vor der Stirn.“
Der Generationenwechsel, die Auswirkungen des Wirtschaftswunders, klingen in den darauffolgenden Gedichten an. Wie die alte Zeit in die neue hineinragt, wird an einem Kleidungsstück angedeutet, das vor dem Krieg Schul- Tanz- und Hochzeitskleid gewesen war. Nach dem Krieg heiratet die Witwe erneut, näht das Kleid der Mode gemäß immer wieder um, und bemerkt zuletzt in der Pianobar nicht mehr, wie altbacken, nicht mehr zeitgemäß, das Kleidungsstück auf die anderen Gäste wirkt. Julia („Julias Kleid“) verwechselt Gelächter mit Bewunderung, erliegt einer Selbsttäuschung, die symptomatisch für die Überlebenden ist. Die Schrecken des Krieges werden verdrängt, die Schuldfrage nicht gestellt. „Die Jungen“ bauen sich deswegen im Gedicht „1968“ „fernab vom Wirtschaftswunderland/sich aus der Asche/eine eigene Welt.“
Mit viel psychologischem Gespür wird im Kapitel „Nachrichten aus der Fünfzigstundenwoche“ der berufliche Alltag, der ein männlicher war, beschrieben. Der Ernährer geht aus dem Haus, befreit vom „Kaffeelavendelbrotgeruch“ der Küche, ein Held, der jeden Morgen wieder seine Familie verlässt, um auf Abenteuerfahrt zu gehen. Sein Traum, wie ein Tiefseefisch nie wieder aufzutauchen, einfach unter Wasser zu bleiben, wird allerdings nie Wirklichkeit, weil er dafür ein „Mann von Gewicht“ sein müsste. Nüchtern übertitelt mit „Der Weg zum Büro“ ist das Gedicht ein herausragendes Beispiel für Reinshagens humorvoll-spitzbübische Poetik, in der durch Sprachspiele eine Mehrdeutigkeit entsteht, die inspirierend ist. Die Lust an der Sprache wird durch ihren phantasievollen Umgang mit ihr geweckt, und es entstehen neue, ungewohnte, mit Emotionen aufgeladene Bilder vor dem lesenden Auge.
Es sind aber nicht nur die poetischen Bilder, es sind auch die herausragenden Monologe, die faszinieren und stark an Bühnengespräche erinnern:
Kollegen
Wenn ich ihn treffe/Früh/Im Paternoster/Auf dem Weg zu Abteilung vier/Und wir reden über das Wetter/Denke ich/Das/Haben wir nicht in der Schule gelernt/Übers Wetter zu reden/Es stand nicht im Lehrplan/Wir haben gelernt/Daß es müßig ist/Übers Wetter zu reden/Wir haben klassische Sachen gelernt/Auch neue Physik/Wir lernten die Kernspaltung und so weiter/Doch nie/Wie wichtig es ist/Übers Wetter zu reden/Ich meine/RICHTIG über das Wetter zu reden/Was zum Beispiel/So ein Wettersturz bedeutet/Diese Druckverschiebung/Diese Kaltfront plötzlich/Sonnenwetter Regenwetter/Frühlings-Sommer-Asthmawetter/oder das jährliche kontinentale Tief…Langsam lern ich jetzt/Mit Mühe/Wie man übers Wetter redet/Lern beim Reden/Übers Wetter/Alle Schwankungen/Des Wetters/Die Veränderungen/In den Reden übers Wetter/Wahrzunehmen/Lern beim Reden/Über die verschneiten Straßen heute/Schüchtern seine Hand zu fassen/Beim Zurückschaun/sehn wir unsere Spur
Ohne Smalltalk ist der fleißige Arbeitnehmer schon damals nicht weit gekommen. Wer ein guter Kollege sein möchte, der sollte auch übers Wetter reden können. Willkommen in der Moderne, in der sinnentleertes, beruhigendes Gequatsche auf die Spitze getrieben wird. Die Schwierigkeit, „ein Gedicht im technischen Zeitalter“ zu schreiben, liegt auf der Hand. Sich der möglichen, bösen Kritik auch in den sozialen Netzwerken auszusetzen, ausgeliefert zu sein – da wird Vertrauen in die Sprache benötigt, gepaart mit dem Wunsch:
„(…) Alle die verramschten Leben/Um mich her (zu) beschreiben/In den müden wundgelaufenen/Und erschöpften Sätzen/Mit den alten abgewetzten/WUNDERVOLLEN/Worten/Punkt.“
Das Ich in „Atem anhalten“ hat viel von der Welt gesehen, ist angefüllt von Erlebnissen, die sich in einem langen, wachen Leben ansammeln. Es war mit verstorbenen DichterInnen bekannt, wie z.B. der Lyrikerin Sarah Kirsch, an die im Kapitel „Vorbilder-Nachbilder“ erinnert wird. „Für Sarah Kirsch“ endet mit folgenden Sätzen, einem klagenden Ruf: „Wo bist du jetzt/Ich höre/Dich/Nicht/Mehr“ und konfrontiert die LeserInnen mit einer tiefen Einsamkeit, die (auch) das Alter mit sich bringt.
Gerlind Reinshagen verharrt jedoch niemals in der Vergangenheit, sondern lässt den Blick schweifen, beschreibt weise den Wandel der Zeit. Dabei erkennt sie Dinge, die uns allen, gerade auch jüngeren Generationen, bekannt sein müssten.


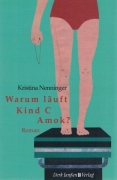
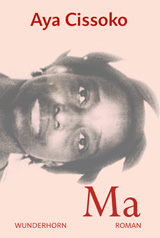



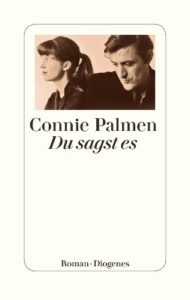
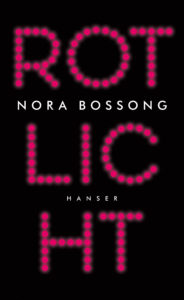



Neue Kommentare