 Schweissgebadet schrecke ich in einer der letzten Nächte auf. Ganz deutlich kann ich mich an meinen gerade erlebten Traum erinnern. Darin sitze ich, gefesselt auf einem Stuhl und umringt von Skinheads, die ich an ihren weißglänzenden Glatzköpfen erkenne, in einem höhlenartigen Raum. Die Skinheads sind gerade im Begriff einer anderen weiblichen Person, ebenfalls gefesselt, die Kehle durchzuschneiden. Ich weiß im Traum genau, dass ich als Nächstes an der Reihe bin – bevor das passiert – wache ich auf.
Schweissgebadet schrecke ich in einer der letzten Nächte auf. Ganz deutlich kann ich mich an meinen gerade erlebten Traum erinnern. Darin sitze ich, gefesselt auf einem Stuhl und umringt von Skinheads, die ich an ihren weißglänzenden Glatzköpfen erkenne, in einem höhlenartigen Raum. Die Skinheads sind gerade im Begriff einer anderen weiblichen Person, ebenfalls gefesselt, die Kehle durchzuschneiden. Ich weiß im Traum genau, dass ich als Nächstes an der Reihe bin – bevor das passiert – wache ich auf.
Sofort bringe ich den Traum mit meiner intensiven Lektüre des Romans 1000 Serpentinen Angst, der Dramatikerin Olivia Wenzel, in dem sie immer wieder Rassismuserfahrungen beschreibt, zusammen. Szenen spielen darin eine Rolle, in denen die schwarze Protagonistin von Rechtsradikalen angefeindet wird oder sich verstecken muss, damit das nicht passiert. Zum Beispiel an einem schönen Sommertag am Strausberger See bei Berlin, an dem sie plötzlich auftauchen:
Mein Freund und ich, wir sind ein Paar, aber kein glückliches; wir haben uns vor einer halben Stunde gestritten. Rechter Terror ist: Als die Nazis kommen, gehören wir wieder zusammen. Sie ziehen sich aus, so wie ich mir das bei Soldaten vorstelle, stramm und zackig. Sie falten ihre Kleidung, stehen aufrecht und steif da, an einem heißen Sommertag, nackt und selbstbewusst, schauen auf den Strausberger Badesee, als gehörte er ihnen. Rechter Terror ist: nicht über diese Steifheit lachen zu können aus Furcht, entdeckt zu werden.
Die Nazis registrieren ein schwarzes Kleinkind im Wasser und kommentieren das mit „Bäh, da war ja ein Neger im Wasser“. Kurz darauf quälen die Protagonistin Verwürfe, sich nicht bemerkbar gemacht zu haben, sondern erst im Auto auf der fluchtartigen Heimfahrt, die Polizei verständigt zu haben.
Warum sich diese Szene so stark einprägt, liegt nicht nur an ihrem Inhalt, sondern an der Form des Erzählens. Perfekt komponiert auch für die Bühne, hakt eine innere oder äußere Stimme nach und bringt die Protagonistin durch Kommentare oder Fragen dazu, über das Geschehene zu reflektieren. Die Figur wird dadurch vielschichtig beleuchtet, ist nicht nur Opfer, sondern fühlt sich auch als Täterin. Sich in so einer Extremsituation korrekt zu verhalten ist schwer, fast unmöglich.
Die Krise, eine Angststörung, scheint vorprogrammiert. Mit Mitte dreißig ist es soweit – die Protagonistin muss sich auf die Suche danach begeben, WER sie eigentlich ist, um nicht verrückt zu werden. Auf ihren Reisen nach Vietnam und in die USA, wird sie immer von der fragenden Stimme begleitet und von dem einen Satz: WO BIST DU JETZT? Eine Stimme, die sie herausfordert, bei der im ganzen Lektüreverlauf nicht deutlich wird, woher sie kommt. Manchmal ist sie provokant-nachbohrend, wie die einer Psychotherapeutin, manchmal fürsorglich, wie die einer besorgten Mutter. Immer hat sie den Effekt, dass die beschriebenen Erfahrungen noch einmal genauer durchdacht werden, auf einen intuitiv dahingesagten Spruch, der Widerspruch folgt. Denn Identität ist fluide, nicht zu fassen, entgleitet permanent, muss sich im Falle der Ich-Erzählerin erst recht als eine solche behaupten.
Wer ihr dabei hilft sich selbst ein stückweit näher zu kommen, das sind vor allem die Freunde, ist weniger die kaputte Familie. Ein roter Faden, ein Erzählimpuls, der immer wieder auftaucht, ist ihre große Liebe Kim. Sie ist die Person, auf die Verlass ist, auch wenn sie die Protagonistin, die ihr eigenes Herz zu Beginn des Romans als Automat aus Blech beschreibt, immer wieder enttäuscht.
In New York erlebt sie endlich was es heißt, das Gefühl zu haben, irgendwo wirklich dazuzugehören, nicht z.B. alleine durch die Hautfarbe Außenseiterin zu sein. Unter Afroamerikanerinnen traut sie sich zum ersten Mal, ohne Scheu eine Banane zu essen, mit verklärendem Blick sieht sie die USA zunächst als Paradies. Zum Ende des Romans heißt es dann nachdenklicher:
Diese warme Community schwarzer Menschen, hier in den USA, ist nur möglich, weil sie jahrhundertelang zum Überleben nötig war. Die Basis, auf der sich diese Menschen begegnen und bestärken, war und ist blutig, ungerecht, qualvoll. Du kannst dankbar sein, dass du willkommener Gast in dieser Gemeinschaft bist, eine Touristin dieser auf Schmerz gewachsenen Blackness. Du kannst froh sein, dass dein Herz hier nur temporär ein paar düstere Schläge imitiert.
Jede Krise hat, wenn sie erkannt und angegangen wird, sein Gutes. Je früher sie im eigenen Leben auftaucht, umso besser. Im Sumpf der eigenen Kindheit herumzutapsen, hier einer „schwarzen“ Kindheit mit traumatischer Ostvergangenheit der Mutter, transportiert aktuelle Wirklichkeiten, denen wir als Lesende gebannt folgen, auch weil sie (bis jetzt) Ausnahmeerscheinungen der deutschen Literatur sind, nicht weil es sie so selten gibt, diese Erfahrungen, sondern weil ihnen die Öffentlichkeit fehlt.
Der Text mischt die eigene Wahrnehmung auf, egal mit welcher Hautfarbe die Lesende geboren wurde. Bester Beweis dafür ist mein Traum, in dem die künstlichen Grenzen zwischen so etwas Banalem wie einer Hautfarbe verschwimmen, der Skinhead vielleicht allgemein für Diskriminierungserfahrungen steht. Denn es geht in 1000 Serpentinen Angst nicht nur um das Thema Rassismus und die persönlichen Erfahrungen der Protagonistin damit, sondern um viel mehr. Um nur ein Beispiel zu nennen etwa darum, was es bedeutet, ein „Ossi“ zu sein. Genauer, was es heißt, als Frau und Teenager in der DDR aufzuwachsen, mit all der Sehnsucht nach Freiheit und gleichzeitig nach 1989 mit dem umzugehen, „was der Westen nach dem Mauerfall mit dem Osten gemacht hat“, nämlich, sich zu bemühen „greifbare, positive Erinnerungen zu zerstören“.
Was bleibt da? Von DIR? Nicht viel, wenn du nicht beginnst, nach dir zu suchen. Vielleicht findest du ein Teil deines Ichs in einem so antiquierten Ding wie einem Snackautomaten, der an einem verlassenen Bahnhof steht. Die Protagonistin spielt mit dem Gedanken hineinzuschlüpfen – nachzugucken lohnt sich also allemal:
Es wäre das Beste gewesen, ich hätte in dem Automaten Unterschlupf gesucht, gleich als ich den Bahnsteig betrat. Es wäre vielleicht das Beste gewesen, ich wäre sofort in diesen Automaten aus Blech eingezogen und hätte darin für ein paar Tage gewohnt. Hätte mich mit einer knisternden Folie aus Zellophan zugedeckt und gegessen, was mir in den Schoß gefallen wäre, hätte mir schließlich eine raschelnde Toilette gebastelt. Ich hätte Ruhe und Zeit gehabt, ich meine, ich liebe Ruhe und Zeit, und ich wäre in Sicherheit gewesen.





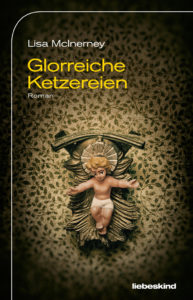
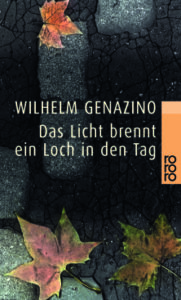


Neue Kommentare