Emotionstheorien gibt es mittlerweile einige. Während sich die analytische Philosophie an den Begrifflichkeiten abarbeitet, versucht die Phänomenologie zusätzlich genauer zu beschreiben, wie Gefühle körperlich erfahren werden. Aurel Kolnai, Philosoph aus der Denktradition Husserls und Schelers, bemerkt in seiner Abhandlung „Ekel, Hochmut, Hass“, Zur Phänomenologie feindlicher Gefühle, in Hinblick auf den Hass:
„Was der Haß verlangt und verheißt, ist eine Art Entscheidung über das Schicksal der Welt„.
Der Sozialphilosoph Axel Honneth kommentiert dazu im Nachwort der Abhandlung: „Wer hasst, so ist Kolnai überzeugt, wird durch das beißende, kaum zu meisternde Gefühl in all seinen Weltbezügen ergriffen; daher kommt dem Hass dieselbe biographische Tragweite zu, die auch Geburtsumstände, Krankheiten oder Charakterformationen für den Einzelnen besitzen.“
Gefühle formen somit das „Schicksal der Welt“, indem sie in allen Weltbezügen mitmischen, und gerade im zwischenmenschlichen Bereich das Individuum darauf hinweisen, dass das eigene Leben letztlich zerbrechlich, aber vor allem unverfügbar ist.
Verfügbar werden sie nur in dem Moment, in dem man jemanden findet, der sie auf irgendeine Art und Weise versteht, weil sie erst dann real, das heißt, erträglich werden.
An diesem Punkt setzt Leslie Jamisons Essaysammlung „Die Empathie-Tests“, Über Einfühlung und das Leiden anderer, an. Im Fokus steht der eigene Schmerz, die eigene schmerzhafte Körperlichkeit, die vom Gegenüber niemals genau auf die Art nachvollzogen werden kann, wie sie sich tatsächlich anfühlt. Das Problem des Fremdpsychischen hält Menschen aber nicht davon ab, zumindest zu versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Empathisch zu sein bedeutet für Jamison, keine Mühen zu scheuen, den tiefen und oft verborgenen Schmerz des Gegenübers für sich erkennbar, also nachvollziehbar zu machen:
„Empathisch zu sein bedeutet herauszufinden, wie man die Probleme anderer ans Licht befördert und so überhaupt erst sichtbar macht. Empathisch zu sein bedeutet nicht nur, zuzuhören, sondern auch, überhaupt erst die Fragen zu stellen, die dann Antworten hervorbringen, die man anhören muss. Empathie bedarf des beharrlichen Nachfragens genauso wie des Vorstellungsvermögens.“
Sichtbar werden Schmerzen dadurch, dass sie beschrieben werden. So eindrücklich wie möglich; am besten so, dass es den Leser/innen selbst weh tut, sie hineingezogen werden in die Qualen anderer. Die Lektüre der Essays wäre aber kaum zu ertragen, wenn die Autorin nicht immer wieder analytische, bewusstseinserweiternde Kommentare zwischen die Beschreibungen über den Schmerz einfließen ließe.
Im ersten Essay: „Die Empathie-Tests“, werden die Leser/innen zunächst mit dem Leiden der Autorin konfrontiert. Die Reise in die Schmerzen der Anderen beginnt somit beim Subjekt der Erzählenden. Ihre Erfahrungen, die Leslie Jamison als Patientendarstellerin in einer Klinik gesammelt hat, lässt sie mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern in Berührung kommen, deren Schmerzvarianten sie möglichst authentisch vermitteln muss. Gute Arbeit kann sie nur leisten, wenn sie sich in den (fiktiven) Körper einfühlt, die Symptome in sich aufsaugt und möglichst authentisch zum Beispiel die „Frau mit den Krampfanfällen“ spielt. Ziel ist es, sogenannte Empathiepunkte an den Medizinstudenten zu vergeben.
Wenig empathische Ärzte begegnen Jamison bei ihrer eigenen Krankheitsgeschichte, aber auch vom Lebenspartner fühlt sie sich während ihrer Operationen unverstanden. Ein guter Freund kritisiert ihre Forderungen mit den Worten:
„Deine Gefühle zu erraten ist, wie eine Kobra mit einem Stethoskop zu beschwören.“
Um Verständnis für individuell empfundene Schmerzen zu bekommen, muss man bereit dazu sein, seine Gefühle mit anderen zu teilen, darf sie nicht weiter für sich alleine beanspruchen. Was der Autorin in der Simulation gelingt, nämlich ihre Gefühle den Studenten so zu vermitteln, dass ihr geholfen wird, funktioniert im eigenen, sozialen Umfeld nur schwer.
Wie werden meine Schmerzen für andere nachvollziehbar und dadurch für mich eine erträgliche Realität, mit der ich nicht alleine bin?
In ihrem zweiten Essay über sogenannte Morgellonkranke mit dem Titel „Teufelsköder“, geht die Autorin dieser Frage auf den Grund. Jeder Mensch hat eine eigene Vorstellung von Realität, und wenn Morgellonkranke meinen, innerlich von Würmern zerfressen zu werden, dann ist das eine Form des Schmerzes, der anerkannt werden muss. Leslies Kritik ist hier, dass die Wirklichkeit der Medizin über die persönlichen Empfindungen einzelner Menschen gestellt wird. Die Autorin besucht ein Treffen der „eingebildeten Kranken“, reist zu ihnen, um zuzuhören und den Schmerz als Schmerz anzuerkennen, auch wenn er nicht ihrer eigenen Realität entspricht:
„Ich habe ihm nicht so geglaubt, wie er wollte, dass ihm geglaubt wird. Ich habe nicht geglaubt, dass Parasiten Tausende Eier unter seine Haut gelegt haben, doch ich habe ihm geglaubt, dass es so weh tut, als ob.“
Auf den ersten Blick wirkt dieses Unterfangen verrückt. Etwas verstehen zu wollen, was eigentlich nicht zu verstehen ist, weil es nachweislich nicht existiert. Ein Grund, warum sich ein Großteil der Bevölkerung von Morgellonkranken abwendet, und Individuen mit dieser Krankheit das Gefühl der Zugehörigkeit in der Welt verlieren, weil ihre Empfindungen als Spinnerei abgetan werden. Jamison kritisiert hier die Vorstellung von einem ganzheitlichen Welt- und Selbstverständnis:
„Das Beharren auf einem dem Subjekt äußerlichen Schadensverursacher entspricht einem Bild vom Selbst als abgeschlossen, als Ansammlung körperlicher, geistiger und spiritueller Komponenten, die zusammen einem Gestaltganzen dienen: dem Wesen selbst. Und das, obwohl dieses Selbst in Wirklichkeit viel weniger integriert und ganzheitlich ist und zur Selbstsabotage neigt – so jedenfalls erlebe ich es.“
Eigene Erfahrungen der Autorin fließen auch in diesem Essay immer wieder mit ein. So meint sie selbst zwischendurch Würmer in der Haut zu spüren, gerät in existenzielle Gefahr, weil sie in ihrer ausgeprägten Fähigkeit zur Empathie das Parasitenkribbeln zu spüren meint. Vielleicht ist das der Grund, warum Morgellonkranke oft sozial völlig isoliert leben, weil die Angst einer Ansteckung nicht dadurch verschwindet, dass man sich vergegenwärtigt, dass es sich um eine eingebildete Krankheit handelt.
Die weiteren Essays sind nicht weniger drastisch in der Darstellung körperlicher Befindlichkeiten. Poetische Überschriften wie „Der ewige Horizont“ oder „Nebelzählung“ können nicht verschleiern, dass Jamison eine Strategie verfolgt, die von Seite zu Seite gerade stark empathiefähige Leser/innen unruhiger macht. In „Der ewige Horizont“ zum Beispiel, beschreibt sie einen Marathon, der alljährlich am Rand des Frozen Head State Park (Tennessee) stattfindet. Es ist ein Wettlauf, der eigentlich nicht gewonnen werden kann, weil die Hindernisse extra darauf ausgerichtet sind, Schmerzen zu bereiten, die Teilnehmer nach dem Schmerz regelrecht suchen. Sie streben nach erfahrbarem Leid als ontologischem Prinzip, als einer Idee, die jedes Jahr verfolgt wird. Dieser Essay ist meiner Meinung nach einer der stärksten, weil er unmissverständlich analysiert, warum Schmerz, und selbst nur das Streben danach, Lust erzeugen kann. Und sei es vor allem deswegen, weil die Zurückgebliebenen sich Gedanken über ihre geliebten Wettläufer machen, sich darum sorgen, ob es ihnen trotz Einsamkeit in der Wildnis gut geht. Die berechtigte Frage nach dem Warum der Schinderei beantwortet Jamison folgendermaßen:
„Ich tue es, weil es so weh tut und ich trotzdem entschlossen bin, es weiter zu tun. Die schiere Grausamkeit der Anstrengung impliziert, dass die Anstrengung es wert ist. Der Zweck liegt in der Sache selbst, nicht in einer ihrer äußerlichen Artikulation.“
Von Essay zu Essay werden die Leser/innen immer stärker in den Sog fremder Emotionen hineingezogen. Wir begleiten die Autorin zum Beispiel hinein in die Seele eines Strafgefangenen, lassen uns zwischendurch auf Sentimentalitäten ein, die nach Ansicht der Autorin nur als sentimental abgestempelt werden und doch dabei eigentlich den Horizont der eigenen Erfahrungen erweitern. Ihr Exkurs zum Thema Süßigkeiten wird zu einer lustvollen Verteidigung aller Naschkatzen und -kater, und es ist eine intellektuelle Freude nachzuverfolgen, wie sie die Begierde nach Süßem mit der Lust nach Sentimentalitäten in Verbindung bringt. Ein Sich-einlassen auf „klebrigen“, süßen Kitsch, ist ihrer Meinung nach manchmal wichtig, um den harten Boden der Realität besser zu begreifen und damit leichter zu ertragen.
In den letzten Kapiteln zum „weiblichen Schmerz“ verliert der Text leider ein bisschen an geistiger Originalität. Schmerz wird bis heute als konstitutiver Bestandteil von Weiblichkeit gesehen, und ist doch vor allem ein allgemeiner Aspekt weiblicher Erfahrung. Hier fehlt es teilweise an neuen Ideen und Erkenntnissen und die Autorin verliert sich in Geschwätzigkeit. Eine Gefahr, die immer besteht, wenn Beschreibungen die Theorie ersetzen und nicht einfach nur literarisch unterfüttern. Die erzählten Erfahrungen der Essaysammlung leben gerade von der analytischen Reflexion und werden ohne diese zu banalen Alltagserfahrungen (z.B. zum Thema Liebesschmerz).
Dass Schmerz immer auch Produkt von Repräsentation ist, also Selbstinszenierung, geht aus den letzten Kapiteln dennoch klar hervor. Warum dieser Schmerz in der Gesellschaft oft nicht ernstgenommen wird, zeugt von der fehlenden Empathiefähigkeit der Welt als einer „Richterin“ darüber, woran der Mensch leiden darf, und woran nicht.
Die Stärke aller Essays besteht darin, dass sie versuchen, die Leser/innen für die (auch ungewöhnlichen) Leiden anderer zu sensibilisieren, die sonst unsichtbar, weil marginalisiert, blieben. Es sind Schmerzen die, wenn sie denn gesellschaftlich anerkannt werden würden, das „Schicksal der Welt„, mit Kolnai gesprochen, also das Leben unser aller, menschlicher machen könnten.
Ob das Leslie Jamison gelingt, hängt aber auch ein stückweit vom Rezipienten ab.
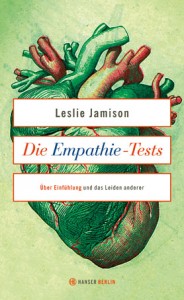

Neue Kommentare