In der Kindheit ist der Wald meist ein dunkler, unheimlicher Ort. In der Phantasie lauern zwischen den Bäumen wilde Tiere, Hexen und Zauberer. Und trotzdem verbringt man gerne spielend seine Freizeit dort, weil die frische Luft die Lungen durchströmt und sich ein Gefühl von entspannter Schwerelosigkeit breitmacht, das in der Stadt nicht aufkommt. Im neuen Roman „Wald“ der österreichischen Autorin und Kolumnistin Doris Knecht ist er für die Protagonistin die einzige verbliebene Rückzugsmöglichkeit. Marianne, die sich selbst Marian nennt, weil der Name für sie „geheimnisvoll, androgyn, genderneutral“ klingt, und sie genau so erscheinen möchte vor den anderen, den Männern und Frauen in der Modebranche und privat, überlebt die Wirtschaftskrise physisch nur knapp, indem sie sich in das Haus ihrer verstorbenen Tante zurückzieht. Auch seelisch ist sie ein Wrack und erfährt in der Zurückgezogenheit der Voralpen zum ersten Mal eine bewusste, wirkliche Einsamkeit, die Knecht in gewohnt scharfgeschliffener Sprache beschreibt:
„Sie gibt sich keine Mühe, zurück in den Traum zu finden. Hat ohnedies keinen Sinn. Er ist dahin. Es war nur geträumt. So gesehen war das Klacken ein Segen: es hat sie aus dem Traum geschleudert, hat den Traum schlagartig beendet, minus den Schmerz, den langsames, allmähliches Erwachen mitunter verursacht, wenn man noch glaubt, das sei es, das sei das eigene, echte Leben und es sei voll mit warmen, netten Menschen…“
Marian friert in ihrer provisorischen Behausung, weil ihr das Holz fehlt, um den Ofen zu beheizen. Ihr fröstelt aber auch, weil da kein warmer Körper ist, an den sie sich drücken könnte, keine warmherzige Stimme, die ihr sagt, dass alles gut werde, sie nicht alleine sei. In Dauerschleifen denkt sie über ihre ehemaligen Lebensgefährten nach und assoziiert Verstandesschärfe mit Attraktivität, die ihr Exfreund Bruno ausstrahlte, und dabei gleichzeitig „kühl“ war. Ganz anders Oliver, ein „warmer“ Verlobter, aber nicht für immer und ewig, weil er eben irgendwann eine andere findet. Marian hadert mit ihrem Absturz, eine ehemals selbstbewusste Modedesignerin mit eigenem Laden und Angestellten. Doch es sind vor allem die falschen Männer, die sie nun in den einsamen Wald getrieben haben, in welchem sie Dinge lernt, von denen sie sich früher als überzeugte Städterin nicht im Traum hätte vorstellen können, dass sie dazu in der Lage wäre. Zum Beispiel ein Reh zu schießen, Forellen zu fangen und auszunehmen, oder Hausmäuse mit der Falle zu jagen:
„Marian hatte Mäuse kleiner in Erinnerung gehabt, zarter, süßer. Möglicherweise sind die Mäuse in der Stadt ja tatsächlich kleiner als Landmäuse. Auch Marian war zarter und süßer gewesen damals, elegant und mitunter exquisit, sie hatte, wenn es die Situation erforderte, zickig und kompliziert sein können, anspruchsvoll und verwöhnt, obwohl sie das alles im Grunde schon damals gar nicht war. Aber als sich einmal der Verdacht bestätigte, dass sie eine Maus hatten, im Apartement in der City, hatte sie darauf so reagiert, wie man es von einer Frau wie ihr erwarten konnte: mit kontrollierter Hysterie. Eine Maus! Um Himmels willen! Gekrabbel, Dreck, Bakterien, angeknabberte Lebensmittel, zernagte Schuhe, ruinierte Abendkleider.“
Als zielstrebige Frau hatte sie sich die Männer erjagt, sich dann aber allzuschnell selbst zur Beute machen lassen. Naiv ihr Herz, aber vor allem ihren Körper verschenkt. Wie mit ihrer großen Liebe Bruno damals, der es verstand, sie berechnend bei der „Stange“ zu halten:
„…und dabei nie ganz heranlassen. Sie mit Häppchen füttern, vielen Häppchen, Zuneigungshäppchen und Interessehäppchen und Häppchen von Foucault, Derrida und Chomsky, mit ganz kleinen Brocken vom großen Wir und ein paar Bröseln Zukunft, gerade immer so viel, dass sie davon nie satt wurde.“
Im Wald wird sie dann plötzlich zum unterworfenen Wild für Franz, den im Dorf angesehenen Gutsbesitzer, der sie beim Wildern erwischt und seine Chance auf sexuelle Abwechslung wittert. So lässt sich Marian auf den starken „Zupacker“ ein, einen Mann, den sie im früheren Leben niemals angerührt hätte, der ihr als „Versorgertyp“ und „Geschäftemacher“ aber gerade zur rechten Zeit über den Weg läuft. Er bringt ihr Holz zum Heizen und Nahrungsmittel. Was sich zunächst wie Prostitution anfühlt, ihre „Kapitulation“, entwickelt sich zu einem Kompromiss, der nicht nur unangenehme Seiten hat, denn auf Franz ist Verlass. Er ist die starke Schulter, die sie im anderen Leben niemals akzeptiert hätte und die sie vielleicht früher schon gebraucht hätte.
Die Anklage der Dorfbewohner/innen, dass sie eine „Hur“ sei, nur weil sie sich endlich „vom richtigen Mann vögeln“ lässt, einem wie Franz, der von nun an in ihrem „Leben herumstocherte und umorganisierte und zupackte“, macht ihr nichts aus. Weil Prostitution für sie zum Leben dazugehört – egal ob auf der Arbeit, in der Ehe oder eben alleine in der Natur. Sie braucht Franz zum Überleben und ihr neues Geschäftsmodell geht auf. Ihre schmerzhaften Erinnerungen an den selbstverliebten Philosophen Bruno, für den sie jahrelang das perfekte Modemädchen mit romantischer Leidenschaft gespielt hatte, letzten Endes aber nur benutzt worden war, verblassen, und sie schöpft eine neue, viel authentischere Kraft. Der „Absturz“ in die Natur zwingt die Protagonistin den Boden unter den Füßen in all seiner Härte zu spüren, und endlich der Suche nach dem eigenen „Wer bin ich“ Raum zu geben. Fern von künstlicher Selbstinszenierung, romantischem Prinzessinnengetue und Gefallsucht. Marian lässt sich nicht mehr zurichten, spielt keine Rolle mehr, deren Hülle aus an sie herangetragenen Normen besteht. Weiblichkeitsnormen, Modemagazinideale. Früher rechtfertigte sie ihre regelmäßigen Hyaluronaufspritzungen der Haut mit der Überzeugung, dass sie das ja für sich mache. Im Haus im Wald korrigiert sie diese Selbstlüge:
„Ich mach das nicht wegen dem x oder dem y oder den Männern überhaupt, ich tu das für mich, ich mache das, weil ich mir so besser gefalle. Das und die Spitzenwäsche und die grotesken High Heels, alles nur für sich selber, wie es auch alle anderen Frauen behaupteten. War natürlich letztlich alles total in den Sack gelogen. War überhaupt nicht wahr, nichts davon oder höchstens an der obersten Schicht der Oberfläche.“
Die zunächst nur schwer zu ertragende Einsamkeit in der Natur bringt die Protagonistin zum Nachdenken darüber, was sie eigentlich vom Leben erwartet, wer sie wirklich sein möchte, und der „Notnagel“ Franz wird zum unterstützenden Halt für einen emanzipierten Neuanfang. Er gibt ihr die Rückendeckung, die sie meinte in ihrem ehemaligen Entwurf als pseudostarke, unabhängige Frau nicht annehmen zu dürfen und die nicht nur für Männer immer schon Grundlage eigener Erfolge ist. Marians Handeln zeigt, dass Emanzipation nicht heißt, als einsame Steppenwölfin gegen den Rest der Welt antreten zu müssen, sondern Hilfe anzunehmen, wenn sie ehrlich gemeint ist.
Die Autorin Doris Knecht versteht es meisterinnenhaft mit ihrem soften Jelinek-Stil unaufdringlich Gruselschauer beim Lesen zu erzeugen, indem sie Machtverhältnisse entlarvt, in denen sich die Grenzen zwischen Täter und Opfer verschieben, die Sehnsucht nach menschlicher Wärme in einer unterkühlten Gesellschaft das Handeln beider Geschlechter dominiert. Letztlich geht es in den Wäldern nicht mehr um Macht und Unterwerfung zwischen den Menschen, sondern um den Versuch, einen Neuanfang gemeinsam zu schaffen. Einen Neuanfang, der mithilfe eines sauerstoffdurchspülten Kopfes am besten zu meistern ist. Der vermeintliche „Rückschritt“ in die (kindliche) Natur ist für Marian eine Chance zu erfahren, ob es die echte Marian überhaupt gibt, und wenn ja, ob sie sich zeigt:
„Sie grübelt viel darüber nach: was sie spielt und was sie ist. Und ob sie etwas geworden ist oder gerade wird, und wenn ja, dann: was genau. Wer. Sie denkt darüber nach in den Nächten, in denen sie wachliegt, und während sie Äpfel schält und schneidet und entkernt und während sie an sonnigen Tagen am Fenster sitzt und das Licht nützt, um ihre Sachen zu flicken. Wer ist sie, wer ist sie noch. Was ist übrig von der alten Marian, und: War die alte Marian überhaupt echt?“
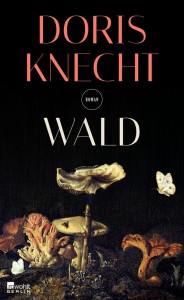



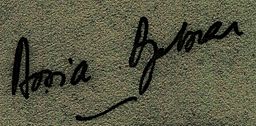

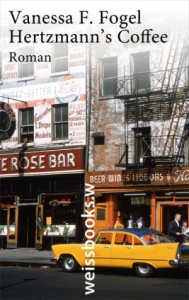




Neue Kommentare