In welchem Alter realisiert ein Mensch, dass das Leben eine andauernde Prüfung darstellt?
In Marlene Streeruwitz neuem Roman „Nachkommen„ läutet diese Erkenntnis den Übergang zum Erwachsensein ein, in dem keine Mutter der Welt die Protagonistin noch vor der grausamen Realität beschützen kann.
„Nachkommen“ thematisiert den Verfall der Literatur im Kapitalismus, einer „Gesellschaft des Spektakels“. Aber es geht noch um viel mehr. Der Text kreist um die alten, ewig bestätigten Macht(ungleich)verhältnisse nicht nur zwischen den Menschen im Allgemeinen, sondern zwischen Mann und Frau.
Protagonistin ist eine 20-jährige Autorin, die es mit ihrem Romandebüt auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Eine lebenskluge Person, die auf die oft gestellte Frage, warum sie denn Literatur mache, dem überforderten Reporter antwortet: „Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Suche nach dem Lebendigen. Literatur.“
Auf dieser bitter notwendigen Suche erfährt sich die Protagonistin selber immer mehr als jederzeit auslöschbares Subjekt, und der verfasste Roman entpuppt sich nicht als der erhoffte Halt in der grotesken Wirklichkeit der Bücherwelt. Denn hier wird über Bücher verhandelt, nicht über Romane. Fiktionale, politisch motivierte Geschichten interessieren nicht, interessant ist die Person, die die „kleine Odyssee“ verfasst hat, und darüber hinaus eine junge, schöne Frau ist.
Beklemmend wirkt es, wenn ein anerkannter Verleger betrunken an den Messestand der Autorin wankt und ihr all seinen persönlichen Lebensfrust mit den Worten entgegenschleudert:
„Ich mag euch junge Frauen nicht. Ihr glaubt wirklich, für euch gilt gar nichts. Keine Regeln. Nichts. Ihr glaubt wirklich, ihr könnt mit der Welt machen, was ihr wollt. Ihr glaubt allen Ernstes, ihr könnt mit eurem Geschreibsel einen Eindruck machen.“
Wie kann sie es wagen, sie, Nelia Fehn, die Tochter einer früh verstorbenen feministischen Autorin, mit ihrem Geschreibsel „alles zu ruinieren“? Was genau der Verleger namens Umlauf mit dieser Anschuldigung meint, bleibt mehrdeutig. Besteht der Fauxpas darin, dass sich die Autorin einen anderen Verleger für ihren Erstling ausgesucht hat? Eine andere Vaterfigur, die keine ist aber gerne eine wäre und die selbstständige Autorin durch sein Verhalten nur zu einem unmündigen Kind degradiert? Oder betrifft die Anschuldigung sie direkt, als schreibende Frau? Eine Frau, die ihre Stimme erhebt, und in ihrer eigenen, nicht männlich dominierten Sprache versucht, die Wirklichkeit zu beschreiben. Ein Ausbruch aus den allgemein anerkannten „Regeln“ des Patriarchats.
Beunruhigend ist es für die alteingesessenen Herren Verleger, wenn sich eine junge, talentierte Frau zu Wort meldet, die gar keine Gedanken daran verschwendet, mit einem von ihnen ins Bett zu gehen. Stattdessen trinkt Nelia Fehn nicht einmal Alkohol, ist Vegetarierin und hält beim Fototermin auf der Messe ein wenig freundlich blickendes Gesicht in die Kamera, weil sie nicht „eines dieser Tausenden grinsenden Frauengesichter“ sein möchte, „die im Bilderdienst des Kapitalismus begraben“ werden. In den Augen der Männer ist sie zickig, nicht domestizierbar, weil sie ihren eigenen Kopf hat. Die viel gefürchtete Wut der Mutter in sich trägt, die sie zwar einsam, aber auch kreativ macht. Eine so ganz unweibliche Emotion und der Grund, warum Nelia ohne leiblichen Vater aufwächst. Brutaler noch: wäre es nach dem Willen des Vaters gegangen, wäre sie niemals geboren worden. Mit wütenden Frauen ist nicht gut Kirschen essen. Dann lieber eine vierzig Jahre jüngere Geliebte, die mit blondierter Haarverlängerung zum Herrn Professor aufblickt und das Bild der unkomplizierten, sanftmütigen Frau verkörpert.
Mit diesem Vater möchte die Autorin eigentlich nichts zu tun haben. Auf der Buchmesse in Frankfurt taucht er jedoch plötzlich auf, ein Totgeglaubter, der ihr gegenüber seine Besitzansprüche äußert. Weil er doch auf seine Tochter stolz ist. Einen Menschen, den er niemals kennen lernen wollte.
Wiederum ist es die Wut, die Nelia widerständig macht und trotzdem nicht verhindert, dass sich beim Fernsehinterview die verinnerlichte, leidige „Kleinmädchenscham“ in ihr ausbreitet. Nur weil sie es gewagt hatte, vor der Kamera eine authentische, also ungewöhnliche Aussage zu machen. Eine Aussage, auf die sie stolz hätte sein können, wenn sie sich nicht gleichzeitig sicher gewesen wäre, dass das kleine, unerfahrene Mädchen gegen die Regeln des „Schlachthauses“ verstoßen hatte:
„Da müssen die durch, wurde da gesagt. Wenn sie (Mädchen) mitmachen wollen, dann müssen sie das aushalten, wurde da gedacht. Die müssen das auch lernen. Einführungen in die Regeln des Schlachthauses wurden da abgehalten. Seminare der Selbsterniedrigung waren das und durchaus für alle.“
Wer gegen die Regeln à la Umlauf und co. verstößt, wird schneller als Frau denkt, zum Verschwinden gebracht. Vegetarierinnen sind da besonders gefährdet. Kein Schlaraffenland für diejenigen, die aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichten und dann nicht einmal wenigstens ihr eigenes junges Fleisch den Schlächtern zum sexuellen Genuss anbieten.
Wer diese Romanbesprechung liest mag denken, Marlene Streeruwitz sei eine Männerhasserin. Das ist sie nicht. Denn die meisten Frauen kommen auch nicht wirklich gut weg. Sympathisch sind nur diejenigen, die sich mit der Autorin auf irgendeine Weise verbünden und ihr ihre Solidarität bekunden. Wenn der Feminismus nach diesem grandiosen Text auch in einer aussichtslosen Sackgasse angekommen zu sein scheint, wird doch eine Möglichkeit sichtbar, wie sich die schreibenden Stimmen der Frauen gegen den Schlachthauswahn behaupten könnten, um mehr als bloß darin zu existieren:
Durch eine aufkeimende Solidarität untereinander, die den allgemeinen Konkurrenzgedanken ausschaltet und alteingesessene Männerklüngeleien aufmischt.
Die Protagonistin ergreift zunächst die Flucht vor dem „Schlachthaus“. Doch wir können uns sicher sein, dass die Wut ihrer toten Mutter in ihr weiterlebt und sie dazu antreiben wird, einen weiteren Roman zu schreiben.
Weil sie gar nicht anders kann, wenn sie denn am Leben bleiben möchte. Ein Zombiedasein wie das ihres Vaters wird sie niemals führen, da sie sich im Gegensatz zu ihm nicht im Unbewussten verliert, sondern sich den tagtäglichen Lebensprüfungen wie eine Erwachsene stellt. Weil sie zum Lebendigsein dazugehören:
„Es ging am Ende darum, wer im Leben am Leben bleiben hatte können und wer da schon tot gewesen war. Dieser Mann war einer von diesen unbewussten Zombies. Dieser Mann war ein Vampir und brauchte das Blut junger Frauen. Die Mami hatte ganz einfach recht gehabt.“
Marlene Streeruwitz hat es mit ihrem Roman leider nicht auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2014 geschafft. Es ist selbsterklärend, warum nicht.


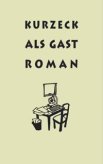


Neue Kommentare