Am Anfang des Romans Glorreiche Ketzereien, der irischen Autorin Lisa McInerney, steht eine alte, (noch) unwissende Frau. Im Affekt erschlägt Maureen, vom Leben hart gebeutelt, einen Einbrecher in ihrem Haus mit einer Devotionalie und löst damit ein Schneeballsystem verhängnisvoller Ereignisse aus.
Ihren Sohn Jimmy, den sie als uneheliches Kind nicht selbst hat großziehen dürfen und mit dem sie erst seit kurzem in Kontakt steht, beauftragt sie mit der Beseitigung der Leiche. Dem Schwerverbrecher und uneingeschränkten Herrscher über die krummen Geschäfte in der Kleinstadt Cork City, gelingt es zwar, den toten Körper verschwinden zu lassen, nicht aber die Schuldgefühle seiner Mutter.
Hier wird ein Motiv eingeführt, das den Roman fortan durchzieht: Der Sündenfall, insbesondere derjenige der weiblichen Figuren. Im Gegensatz zu den männlichen werden sie von den Moralvorstellungen der katholischen Kirche regelrecht verfolgt, bis sie begreifen, dass sich die Kirche ihre Sünder schafft, damit sie jemanden hat, den sie retten kann.
Diese Erkenntnis, ausgesprochen von Maureen, erinnert an den kürzlich angelaufenen, beeindruckenden Dokumentarfilm #Female Pleasure, in dem eine Novizin einer Oberin ihre Vergewaltigung durch einen vorgesetzten Geistlichen schildert und diese nicht etwa den Täter anzeigt, um den Skandal öffentlich zu machen, sondern der Novizin die Sünde großmütig „vergibt“.
Die Kirche als moralische Instanz schwebt über der Handlung wie ein Damoklesschwert, denn sie ist es, die das Unheil bringt. Anstatt den Säufern, prügelnden Vätern und gefallenen Mädchen Halt zu geben, droht sie mit Verdammnis, wenn die Schäfchen nicht Buße tun.
Sündige Engel, denen niemand beisteht, sind prädestiniert dafür, immer weitere Fehler zu machen, zum Beispiel die falschen Fragen an die falschen Leute zu richten. Menschliche Fragen, die dazu führen, dass an einem schnell vertuschten Verbrechen plötzlich mehr Schicksale hängen, als denjenigen lieb ist, die es verursacht haben.
Maureen realisiert allerdings recht bald, dass nicht nur die katholische Kirche verantwortlich ist für zerbrochene Lebensentwürfe, sondern die Frauen untereinander dazu beitragen, unglücklich zu werden. Nach Maureen, der in der Story mehr und mehr Erleuchteten, existieren verschiedene Kategorien von „Frau“ gegen die es zu rebellieren gilt, anstatt sie untereinander immer wieder selbst zu bestätigen:
Das („Kategorien“) sind die Mütter. Die Biester. Die Ehefrauen. Die Freundinnen. Die Huren. Frauen haben nichts gegen eine solche Einteilung, solange sie nur zur richtigen Gruppe gezählt werden. Und alle sehen auf die Huren herab.
Nach dieser Erkenntnis begreift zumindest eine Figur, wie sich das Böse ausräuchern lässt, ohne dabei Unschuldige zu verletzen. Ein Leben für ein Leben, so lautet Maureens einleuchtende Kalkulation, die eine Möglichkeit ist, aus dem Teufelskreis herauszukommen, der durch Schwarz-Weiß-Malereien entsteht. Nicht zuletzt aus dem eigenen.
Der vielschichtige, meisterinnenhaft komponierte Roman erzeugt nicht nur durch den Plott eine soghafte Wirkung, sondern wirft gleichzeitig einen aktuellen Blick auf die irische Gesellschaft, die sich seit den Kindheitserinnerungen des Bestsellerautors Frank McCourt (Die Asche meiner Mutter) positiv verändert haben müsste. Themen wie (soziale) Armut, Drogen und Gewalt in der Familie, denen Staat und Katholizismus machtlos gegenüberstehen, erzählen allerdings von einem krisengeschüttelten Land, dessen Probleme Europa egal zu sein scheinen.
Der Raum, in dem sich Einzelschicksale poetisch zu einem großen, zusammenhängenden Ganzen vermischen, ist Cork City. Eine schlafende, unparteiische Kleinstadt, die keine Notiz nimmt vom alltäglichen Wahn, weil sie als bloße Hülle funktioniert, in dem das Atmen, Pulsieren, Schlucken, Schwitzen, die Qualen und Wonnen von hunderttausend kleinen Leben stattfindet.
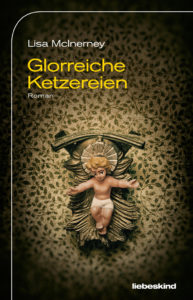
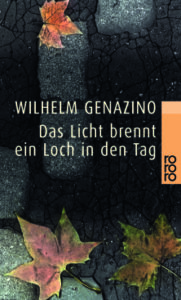
Neue Kommentare